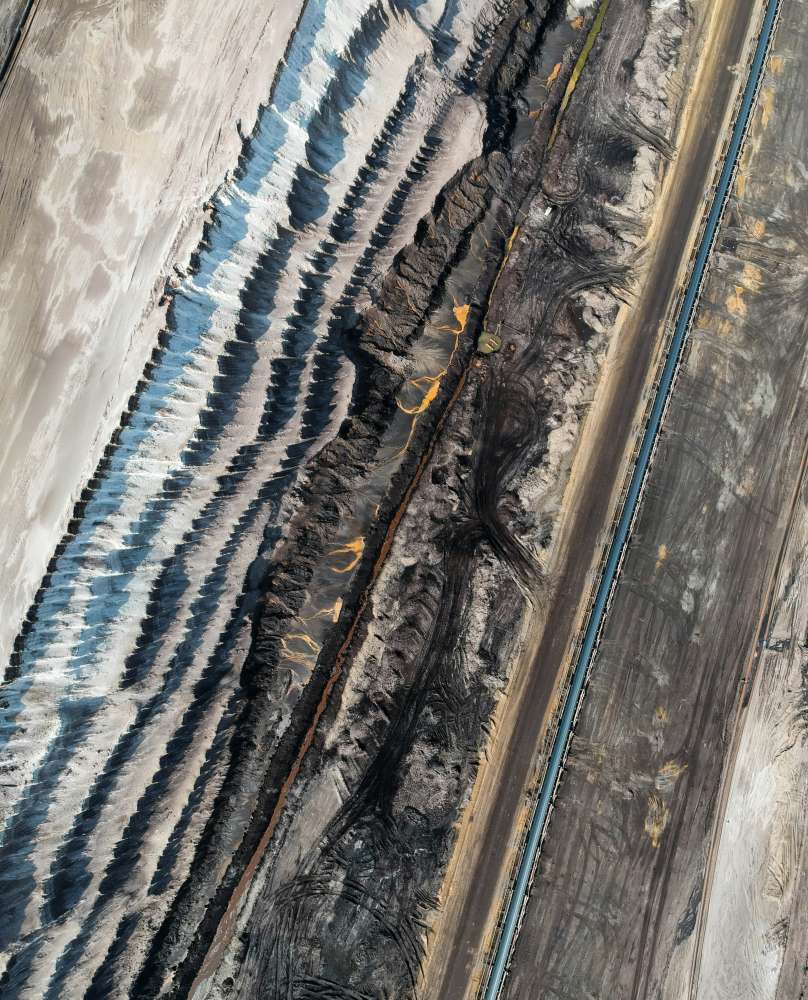Ohne Helden geht es nicht

Wehrmachtsdevotionalien, entwürdigende Ausbildungspraktiken, sexuelle Belästigung, Demütigungen und der Fall um Franco A – 2017 häufen sich die Vorwürfe gegenüber der Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium zieht die personellen und organisatorischen Konsequenzen: Generale werden entlassen, der Traditionserlass neu aufgelegt, das Konzept Innere Führung geprüft, Kasernen umbenannt. Reicht das aus, um den Problemen der Bundeswehr beizukommen?
Sicher nicht, denn klar ist, dass solche Reformpflaster die Skandale kaum verhindert hätten. Im Fall um Franco A wurden über Jahre Warnzeichen ignoriert, Kameraden und Vorgesetzte schauten weg. Lange bevor es zum Entstehen einer rechten Terrorzelle kommt, bevor sadistische Gewaltexzesse und sexueller Missbrauch auftreten, müssen Soldatinnen und Soldaten einschreiten – dazu braucht es ein soldatisches Berufsbild, dass nicht befohlen werden kann. Vielmehr erwächst es aus ehrlicher Anerkennung, die der Bundeswehr selten gewährt wird.
Was das soldatische Berufsethos ausmacht, beschreibt der Militärhistoriker Klaus Naumann in einer Veröffentlichung des Bundeswehrverbands zum Thema. „Soldat zu sein ist kein Beruf wie jeder andere“, heißt es dort, denn „die Bereitschaft, mit dem Leben für den Auftrag einzustehen, die Verpflichtung zu Tapferkeit und Treue (siehe Eidesformel), der Dienst an der Gemeinschaft – das alles sind Selbstverpflichtungen, die über das normale Maß moralischer Pflichten hinausgehen.“ Diese Bereitschaft sei Grundlage des soldatischen Berufsethos, gelebt durch Tapferkeit, Kameradschaft und vor allem ein Ehrverständnis, das sich an den Werten von Recht und Freiheit orientiert. Daraus, so Naumann, leiten Soldaten ihre Würde und ihren Anspruch auf Anerkennung ab.
Solche Anerkennung für den Soldatenberuf zu stiften fällt angesichts der Skandale der letzten Monate jedoch schwer, auch wenn diese nach genauer Prüfung teils gar keine sind. Die binnenkulturellen Defizite der Bundeswehr sind real und existieren über Missbrauchsvorfälle wie in Bad Reichenhall hinaus: Während meiner 2015 absolvierten Grundausbildung war ich schockiert über augenzwinkernde Kommentare zum zweiten Weltkrieg und der Wehrmacht, betrunkene Vorgesetzte, einen Ausbilder, der mit untergebenen Soldatinnen schlief. Das war keinesfalls Alltag und schmälerte auch nicht meine Bewunderung für andere, beispielhafte Kameradinnen, Kameraden und Vorgesetzte. Doch auch wenn die Mehrheit der Soldaten tadellos Dienst tut – der Verweis auf Einzelfälle und schwarze Schafe in der Bundeswehr ist nicht aufrichtig, denn es bleibt ein Mangel an Soldaten, die solches Verhalten unterbinden.
Ohne Zweifel muss die Bundeswehr selbst Maßnahmen ergreifen gegen feiges Führungsversagen, das Prävention und Aufklärung von Missständen verhindert. Doch der kollektive Fingerzeig auf bundeswehrinternes Versagen ist zu einfach und lässt die gesellschaftliche Verantwortung gegenüber der Truppe unter den Tisch fallen: Ein Ehrverständnis, welches Soldaten gebietet, im Zweifel nicht wegzusehen, sondern Recht und Freiheit auch nach innen zu verteidigen, selbst wenn sich Vorgesetzte schuldig machen, braucht Würde und Anerkennung für den Beruf.
Seien wir einmal ehrlich zu uns selbst: Wir finden es nicht nur erschreckend, dass Soldaten in der Ausbildung erniedrigt werden oder die Wehrmacht in irgendeiner Weise identitätsstiftend für die Bundeswehr ist. Wir hegen ein grundsätzliches Unbehagen demgegenüber, was für viele Soldatinnen und Soldaten wichtige Werte sind: Stolz, Disziplin, Leistung, Befehl und Gehorsam. Und auch: Heldentum und die Bereitschaft, für eine größere Gemeinschaft „Volk“ das eigene Leben zu lassen.
Aus gutem Grund: In unserer „postheroischen Gesellschaft“ (Herfried Münkler) ziehen wir nicht mehr heldenhaft in den Krieg, und quittieren alles Militärische mit gehobenen Augenbrauen. Das ist Ergebnis eines gesunden Lernprozesses aus der Geschichte eines Landes, das sich mit gesellschaftlicher Begeisterung in zwei selbstverschuldete Weltkriege warf. Andere postheroische Gesellschaften mögen die Aufgaben der Gefahrenabwehr bedenkenlos an kampfbereite „heroische Gemeinschaften“ delegieren, doch die deutsche Nachkriegsdemokratie hat beim Umgang mit Gehorsam, Gewalt und Gewissen besonders hohe Ansprüche an das Militär – Stichwort Innere Führung.
Das ist die richtige Konsequenz aus Deutschlands Erfahrungen mit Militarismus und Imperialismus. Doch sind hohe gesellschaftliche Ansprüche eben nicht genug, um die Funktionsprinzipien einer liberalen Demokratie mit denen einer professionellen Armee zu versöhnen – damit „Staatsbürger in Uniform“ und „Innere Führung“ nicht nur floskelhaft wiederholt werden, müssen wir anerkennen, dass die Opferbereitschaft von Soldatinnen und Soldaten sie zu etwas Außergewöhnlichem macht.
Das zu verneinen bringt eine Form von Selbstbetrug im Umgang mit der Bundeswehr mit sich, die über die legitime Ablehnung des Militärs aus politischen oder ethischen Gründen hinausgeht: Die große Mehrheit der Deutschen, welche die Bundeswehr grundsätzlich für notwendig hält, darf sich nicht in die Illusion flüchten, es könne in einer postheroischen Gesellschaft auch eine vollständig postheroische Armee geben – ohne Korpsgeist, oder gar ohne Befehl und Gehorsam.
Denn das verkennt die Einsatzrealitäten einer Armee, welche in Afghanistan und in Mali unter dem Label „Friedensmission“ im Kriegseinsatz gegen Milizen kämpft. Und auch wenn wir in 99% der Fälle keine Probleme zum Beispiel bei der Luftraumsicherung über dem Baltikum erwarten: Ein durchgedrehter russischer Pilot reicht schon aus, und wir erwarten von unseren Soldatinnen und Soldaten, diesen auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens aufzuhalten. Ohne die Bereitschaft, Opfer zu bringen, gibt es kein Militär.
In der Praxis sind Opferbereitschaft und Heldentum keine politischen Begriffe. Psychologen bestätigen, was Soldaten mit Einsatzerfahrung berichten: Opferbereitschaft gilt primär den Kameraden – am Hindukusch sind politische Abstraktionen wie Volk und Vaterland weit weg. Das sollte es der postheroischen Gesellschaft leichter machen, Soldaten Werte wie Heldentum zuzugestehen. Bleibt dieses Zugeständnis dennoch aus, entsteht ein gefährliches Vakuum, besonders für Rekruten, die nach Strukturen suchen, in denen Stolz am Beruf, Heldentum und Opferbereitschaft nicht abfällig betrachtet werden. Dass solche Werte legitime Motive für die Entscheidung zugunsten des Soldatenberufs sind, müssen wir anerkennen. Denn wenn außerhalb der Bundeswehr keine Möglichkeit zur Identifikation und Reflexion des beruflichen Selbstverständnisses besteht, lassen wir unsere Soldaten im Stich. Es ist eine tragische Ironie, wenn unsere antifaschistische motivierte Ablehnung von Heldentum und Opferbereitschaft das Feld denen überlässt, die rechte Ideologien glorifizieren und das „stolze Soldatentum“ von Hitlers Wehrmacht rühmen.
Wo das geschieht, braucht es aufrichtige Soldatinnen und Soldaten, die sich aus Ehrverständnis dagegen aussprechen, anstatt aus falsch verstandenem Korpsgeist wegzusehen. Dazu müssen sie sich aber darauf verlassen können, beim Bekanntwerden von Verfehlungen nicht mitsamt ihrem gesamten Berufstand unter Generalverdacht gestellt und pauschal als rechts, archaisch, oder sexistisch abgestempelt zu werden. Das Dilemma: Ein modernes soldatisches Berufsethos würde Verfehlungen in der Bundeswehr vorbeugen, setzt aber gesellschaftliche Anerkennung voraus – diese wiederum wird es nicht geben, solange die Bundeswehr vor allem durch Fehlverhalten, Führungsversagen und bizarre Skandale in Erscheinung tritt.
An dieser Stelle kann man die Rückkehr zur Wehrpflicht fordern: Staatsbürger sollen wieder Uniform anlegen, um liberale Werte in die Bundeswehr zu tragen, so das Argument. Es ist zwar richtig, dass ohne Wehrpflicht immer weniger Familien mit der Bundeswehr in Kontakt kommen, was das Prinzip des Staatsbürgers in Uniform vor neue Herausforderungen stellt. Doch der Ruf zur Wiedereinführung der Wehrpflicht verkennt nicht nur die rechtlichen und politischen Hürden, die einer Wiedereinführung des Pflichtdienstes im Weg stehen, sondern auch, dass die Bundeswehr faktisch schon lange eine Freiwilligenarmee ist, in der auch vor 2011 vieles falsch lief. Doch auch ohne die Wehrpflicht können Deutsche mit und ohne Uniform konkrete Schritte dahingehend unternehmen, das gegenseitige Verständnis zu verbessern und damit ein modernes berufliches Selbstverständnis in der Bundeswehr zu fördern.
Gegenwärtig studieren Offizieranwärter isoliert an Bundeswehruniversitäten. Die Armee sollte Modelle entwickeln, dass angehende Offiziere mehr an zivilen Hochschulen studieren können und auch die Bundeswehruniversitäten stärker für Nicht-Soldaten öffnen. So wären Offiziere näher an der zivilen Welt und den gesellschaftlichen Erwartungen, während sich Zivilisten mit solchen Mitstudierenden auseinandersetzen könnten, die ihr Leben für die Verteidigung der Gesellschaft zu riskieren bereit sind. Das wäre auch ein wichtiger Schritt, um die heute verschwindend geringe öffentliche Präsenz der Bundeswehr zu stärken. Denn wo sind die Stimmen junger Offiziere in Talkshows oder den Kommentarspalten der Tageszeitungen?
Um kritische Stimmen aus der Bundeswehr hörbar zu machen, muss zudem ein Wandel bei der Bundeswehr erfolgen: Gegenwärtig leiden die Karrieren von kritischen Soldaten, öffentliche Äußerungen von Uniformierten sind selten. Würde die Bundeswehr mehr Kontakt mit den Medien suchen, ließe sich auch die mediale Skepsis lindern, die Christian Thiels, Verteidigungsexperte der Tagesschau, beschreibt: Medien berichten unzureichend über die Bundeswehr, es erfolgt wenig Auseinandersetzung mit dem beruflichen Alltag und den Herausforderungen des Soldatentums, damit befasste Journalisten werden von Kollegen als skurril wahrgenommen. Auch öffentliche „Tage der Bundeswehr“ sind ein Schritt in die richtige Richtung, um die Präsenz der Streitkräfte zu erhöhen. Doch auch auf kleinster Ebene lässt sich die Sichtbarkeit erhöhen: Soldaten sollten ermutigt werden, ihre Uniformen öfter in der Öffentlichkeit zu tragen. So trivial das auch klingen mag: Schon der spontane Austausch auf dem Supermarktparkplatz oder dem Bahnsteig kann dabei helfen, einander besser zu verstehen.
Wenn wir die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft wollen, müssen wir anerkennen, was Soldaten ausmacht, und dass Opferbereitschaft dazu gehört. Abstrakt funktioniert das nicht – wir müssen mit der Bundeswehr in regelmäßigen, vorurteilslosen Austausch treten, und unsere Staatsbürger in Uniform kennen lernen. Dabei ist es nicht das Ziel, allen in Uniform bedingungslos auf die Schulter zu klopfen, sondern das Verhältnis zur Bundeswehr dahingehend zu verändern, dass wir – einzelne Bürgerinnen und auch Institutionen wie Kirchen und Parteien – dann glaubwürdig Dank und Anerkennung stiften können, wenn es unseren Werten und Erwartungen entspricht, sei es bei der Seenotrettung im Mittelmeer oder in Europas Vorgehen gegen den Terror in Mali und im Irak.
Für die Entwicklung eines mit unserer Demokratie kompatiblen, professionellen soldatischen Berufsethos ist echte Anerkennung unabdingbar – und Voraussetzung dafür, dass berechtigte Kritik nicht wie bisher so häufig auf taube Ohren stößt. Der Sicherheitspolitiker Winfried Nachtwei bringt es auf den Punkt: „Kommunikation, Diskussion, Streit, ja. Ausgrenzung nein!“
…
This commentary originally appeared in the August 13, 2017 print edition of Tagesspiegel. An earlier version was published by Tagesspiegel Causa on July 20, 2017 and in English by War on the Rocks on June 29, 2017.